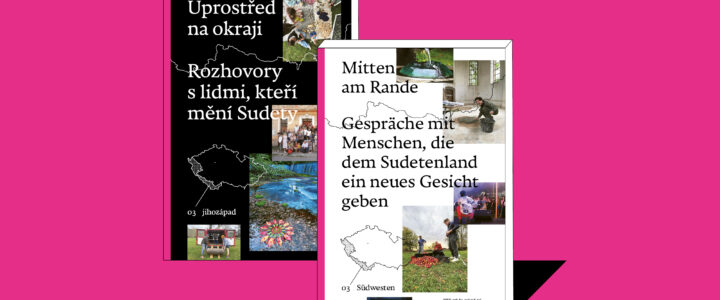Das Anliegen der Bürgerinitiative Antikomplex (https://antikomplex.cz) ist eine kritische Reflexion der tschechischen Geschichte. Bekannt wurde sie nicht zuletzt durch die Ausstellung und Dokumentation „Das verschwundene Sudetenland“. Viel zu wenig Beachtung findet ihre vierteilige Publikationsreihe „Mitten am Rande. Gespräche mit Menschen, die dem Sudetenland ein neues Gesicht geben.“ Entstanden ist diese ausführliche Serie von Interviews mit engagierten Persönlichkeiten aus dem ehemaligen Sudetenland, als die Staatsgrenzen wegen der Pandemie geschlossen waren. Es handelt sich sozusagen um eine tschechische Binnenperspektive – für deutsche Leser umso interessanter. Die vier jeweils zweisprachigen Bände beschäftigen sich mit dem Nordwesten (Band 1), dem Nordosten (Band 2) und dem Südwesten (Band 3). Nachdem die Finanzierung nun gesichert ist, wird demnächst auch ein Buch über den Südosten (Band 4) erscheinen. Gespannt war ich auf den aktuellen dritten Band – er beschäftigt sich mit der Region zwischen Sankt Joachimsthal bis zum Gratzener Bergland.
In ihrem Vorwort schreiben Veronika Kupková und Michal Urban über ihre oft erst nach dem Fall des eisernen Vorhangs zugezogenen Gesprächspartner: „Es ist wahrhaft ein buntes Mosaik an Menschen, die unermüdlich gegen Gleichgültigkeit, Hoffnungslosigkeit und gegen das Vergessen kämpfen.“ Mut und Enthusiasmus, oft auch einfach die Liebe zur Region oder Landschaft, sind der rote Faden, der sich durch die Interviews zieht. In fast allen Gesprächen geht es auch um die tschechisch-deutschen Beziehungen, zumeist auf einer ganz unpolitischen, zwischenmenschlichen Ebene.
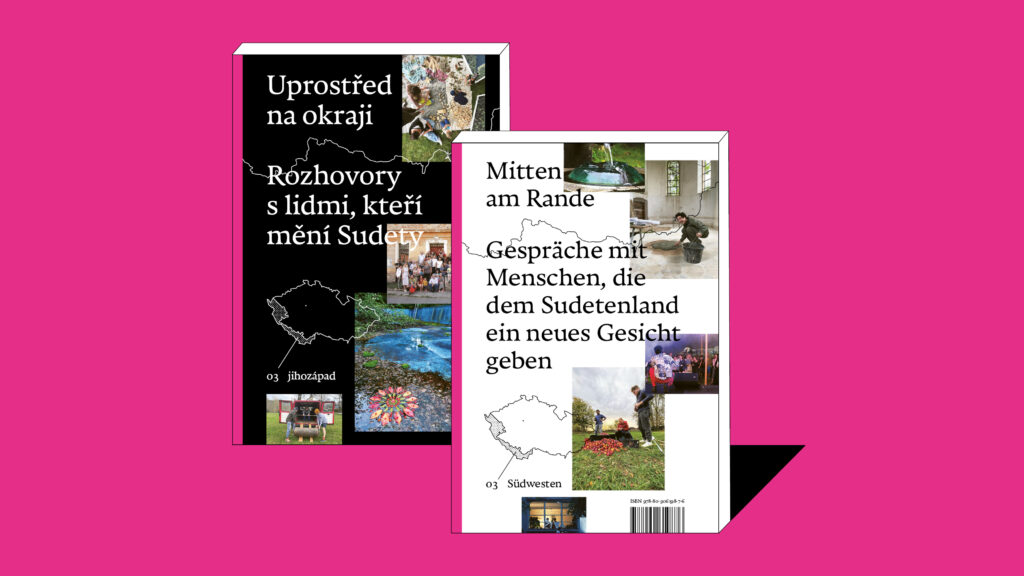
Lucie Poláková, die sich vor 30 Jahren in der Umgebung von Asch (Aš) niedergelassen hat, kommt es so vor, als sei das Sudetenland immer noch etwas verwunschen. „Verwunschen durch das Unrecht das die Menschen hier irgendwie in sich tragen, obwohl es sie oft nicht betrifft. Verwunschen durch die Vertreibung, die so viel Leid verursachte. Verwunschen aber auch durch die Vorkriegsgeschichte, die wir nicht wirklich kennen. Verwunschen durch verschwundene Dörfer, die dem Boden gleichgemacht wurden.“ Das, was engagierte Menschen in diesen Gegenden leisten, beschreibt sie in ihrem Einleitungstext als „Heilungsprozess“.
Ganz konkret wird der Archäologe Filip Prekop, der sich für den Denkmalschutz engagiert. Am Beispiel der Stadt Lauterbach (Čistá), die am Ende der 40er Jahre Militärübungen zum Opfer fiel, beschreibt er nicht nur die brutale Zerstörung der Stadt, sondern auch, wie stumme archäologische Funde die bewegende Vergangenheit wieder zum Leben erwecken. Der Verein, in dem er sich engagiert, trägt den treffenden Namen „Terra incognita“.
Ein Beitrag ist dem Verein „Domaslav“ gewidmet, der sich in Böhmisch Domaschlag (Domaslav) um die Erhaltung des Pfarrhauses und der Jakobuskirche kümmert. Marie Dlouhá berichtet über die engagierten Mitglieder des Vereins, die es regelmäßig aus Pilsen in den kleinen Ort führt. Sie sind sozusagen die Nachfolger von Jugendlichen, die ihrem in den 80er Jahren dorthin verbannten Priester folgten und diese Gemeinschaft aufbauten. Den dritten Band, von dem hier die Rede ist, hat Veronika Kupková übrigens im Juli 2025 während der tschechisch-deutschen Veranstaltung „Setkání/Treffen“ in der noch immer renovierungsbedürftigen Kirche vorgestellt. Das Treffen begann wie stets mit einer Heiligen Messe – der einzigen im ganzen Jahr. Marie Dlouhá sieht das so: „Wenn dann die Leute zur Messe kommen, manchmal zehn, ein anderes Mal dreißig, manchmal waren es sogar fünfzig oder noch mehr. Da merkt man, dass nicht die Statuen und der Stuck entscheidend sind, sondern die Menschen, die sich dort treffen. Und sie kommen nicht, weil sie Christen oder Katholiken sind, sondern weil sie zusammen sein möchten und gerne hier sind.“ Viele der Vereinsmitglieder haben inzwischen eine Familie gegründet und stellen, wenn es um die Zukunft solcher Orte geht, ganz pragmatisch fest: „Die Zugänglichkeit von Bildung entscheidet darüber, ob in der Region eine neue Generation heranwächst.“
Nur wenige Kilometer entfernt, in Neumarkt (Úterý), hat der Verein „Bart“ bereits vor einigen Jahren die über dreihundert Jahre alte Orgel in der Kirche Johannes der Täufer gerettet. Niemand hatte sich in der Vergangenheit für sie interessiert, sodass die Orgel – im Gegensatz zu vergleichbaren Instrumenten – in ihrer ursprünglichen Form erhalten geblieben war. „Bart“ veranstaltet jedes Jahr ein internationales Musiksymposium, in dessen Mittelpunkt die Neumarkter Orgel steht. Inzwischen hat der Verein die Rekonstruktion eines Barockhauses am Hauptplatz auf sich genommen, um dort ein Gemeinschaftszentrum einzurichten. Tomaš Kaiser, der Vereinsvorsitzende, beschreibt in dem Gespräch den Rekonstruktionsprozess als Erinnerungsarbeit: „In Neumarkt beginnt die Geschichtsschreibung im Jahr 1945. Und meiner Meinung nach bemüht der Mensch sich immer, die leeren Flecken zu füllen.“ Kaiser sieht eine klare Grenze zwischen den nach dem Krieg Angesiedelten und den neu Zugezogenen. Letztere stellen in dem Verein die Mehrheit. Auch Unverständnis schlägt ihnen entgegen, weil ein solches Engagement „hier nicht üblich ist.“ Aber: „Nach und nach gewinnen wir das Vertrauen der Leute.“ Zum Zeitpunkt des Interviews war es noch nicht soweit, aber mittlerweile finden in dem Haus Veranstaltungen statt. Im Mai 2024 kam der tschechische Kulturminister zur Einweihungsfeier.

Lucia Pec wurde in Deutschland als Tochter tschechischer Eltern geboren. Inzwischen lebt sie in Rehberg (Srní), betätigt sich als Naturführerin und gestaltet universelle Landart. Zwar spielt die Geschichte des Grenzlandes für sie durchaus eine große Rolle, zu ihrem Ort hat sie als Künstlerin aber einen vollkommen offenen Zugang: „Die ehemaligen Dörfer nehme ich als herrliche, magische Orte, die zur Natur zurückgekehrt sind.“
Ebenfalls in Rehberg fand Václav Sklenář sein Lebensthema. Bereits im Jahre 1998 gründete er den deutsch-tschechischen Verein „Karel Klostermann Dichter des Böhmerwaldes“ und half, Klostermanns Werke in beiden Sprachen herauszugeben. Klostermann war ein deutsch-böhmischer Schriftsteller. Sein Hauptthema: der Böhmerwald. In Rehberg soll das ehemalige Pfarrhaus zu einem Karel-Klostermann-Haus ausgebaut werden.
Einen spannenden Einblick in den Ort seiner Kindheit gewährt David Vereš, der im Centrum Bavaria-Bohemia tätig ist, im Einleitungstext zu einem der vier Abschnitte, in die das Buch aufgeteilt ist. Aufgewachsen ist er in Zwetbau (Svatobor), einem Ort auf dem Truppenübungsplatz Hradište: „Ich erforschte die Keller der zerfallenen Häuser und fand Porzellanscherben mit mir unbekannten Buchstaben wie ü, ä oder ö.“ Während der Militärübungen mussten die Kinder aus dem Dorf Passierscheine vorweisen, um von der Schule nach Hause zu kommen. Besuche waren nur nach vorheriger Anmeldung bei der Kommandantur möglich. Diese ungewöhnlichen Erfahrungen wären durchaus einen längeren Beitrag wert gewesen.
Über Erwerb und Renovierung eines Renaissancehauses in Joachimsthal (Jáchymov) erzählt Milana Pincová. Mittlerweile hat sie dort zusammen mit ihrem Mann ein Café eingerichtet, das für Stadtbesucher und Einheimische zum Treffpunkt geworden ist. Über die 90er Jahre berichtet die ehemalige Pragerin: „Zahlreiche Leute aus Prag sagten uns: ‚Was habt ihr da getan? Seid ihr verrückt geworden?“ Ganz abwegig scheint sie diese Frage im Rückblick nicht zu finden. Die Anerkennung des Hauses als Kulturdenkmal hat es der Familie ermöglicht, überhaupt Förderungen für das Projekt zu erhalten: „Wir lassen nichts auf die Denkmalschützer kommen!“
In Elsch (Olešna) erwarb Prokop Šícha ein verfallenes Pfarrhaus; dazu kam per Zufall noch eine Kapelle, für deren Rettung er den Verein „Zachraň Annu“ („Rette Anna“) gründete. Der Eigentümer der Kapelle lebte auf einer Insel nahe Bangkok und hatte eigentlich gar kein Interesse an dem Gebäude. Šícha erwarb es dann für einen symbolischen Betrag und begann nach der Gewährung von Fördermitteln, das Dach zu renovieren. Weitere Arbeiten fanden mit Pfadfindern und Freunden statt. Während der Pandemie wurde Elsch für viele von ihnen zu einem Zufluchtsort. Prokop ordnet die Bedeutung des Projekts so ein: „Obwohl der ursprüngliche Grund für den Kauf der ästhetische und historische Wert war, ist das nicht der Grund, warum wir das Haus herrichten. Den Wert erhält es dadurch, dass wir es nutzen und dort gelebt wird.“ Typisch für viele Projekte ist seine Feststellung: „Man kauft zuerst und dann stellt man sich die Frage, was macht man damit.“
Markéta Kotěšovcová ist Dorfschuldirektorin in Tschachrau (Čachrov). Zu dieser Position kam sie eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde, suchte sie doch anfangs nur nach einer passenden Schule für ihr Kind. Im Gespräch skizziert sie ihr Konzept, Kinder zu Persönlichkeiten zu erziehen. Die pädagogische Herangehensweise ist dabei vom Ort keineswegs unabhängig: „Die Landschaft im Vorland des Böhmerwalds […] stellt für alle das beste Lehrbuch dar.“ Eine nachhaltige Wiederbelebung durch den Menschen braucht die Region ihrer Auffassung nach am meisten. Die Aufmerksamkeit für Landschaft, Natur und Umwelt, betont Kotěšovcová, kann aber nicht von der Schule herbeigezaubert werden; sie muss aus der Familie kommen.
Um die Instandsetzung des Schlosses Zetschowitz (Čečovice) bemüht sich die tschechische Vereinigung der Denkmalschützer. Deren Mitglied Miroslava Šusová berichtet, wie der Staat das teilweise ausgebrannte und bereits zum Abriss freigegebene Schloss für eine Krone abgegeben hat. Das Vorhaben, Fördermittel zu akquirieren, scheitert zumeist am obligatorischen Eigenanteil. Geld für die Reparaturen spielt der Verein jedoch durch kulturelle Events ein, die in der tschechischen Musikszene inzwischen einen Namen haben. Nebenbei kommt so ganz unverhofft die große Kultur in das kleine Grenzland.
Seitdem die Nikolauskirche in Poletitz (Boletice) durch die Verschiebung der Grenzen eines Truppenübungsplatzes wieder zugänglich ist, kümmert sich Lenka Augustinová mit dem Verein „Radost pro vsechny“ („Freude für alle“) um deren Erhaltung. Ein eindrucksvolles Foto zeigt eine Kindergruppe auf provisorischen Bänken, während an der Wand kyrillische Graffiti ins Auge springen. Als die Vereinsmitglieder die Kirche vom Gestrüpp befreiten, fanden sie Grabsteine, die sie später wieder aufstellten. In wenigen Zentimetern Tiefe lagen zudem zahlreiche Gebeine: „Wir haben in der Leichenhalle eine riesige Eichentruhe, in die wir all diese Gebeine betteten.“ Inzwischen hat ein Arbeitstherapeut aus einer nahe gelegenen psychiatrischen Heilanstalt das Projekt entdeckt. Die Patienten leisten bei ihren therapeutischen Einsätzen wertvolle Unterstützung. Die verfallene Kirche entfaltet auf diese Weise sogar heilende Wirkung.

Aus dem Gratzener Bergland berichtet Michaela Vlčková. Die erst spät besiedelte Region hatte es nie leicht; ihre kulturellen und wirtschaftlichen Bindungen pflegten die Bewohner traditionell in das nahe Österreich. Der eiserne Vorhang und die Zerstörung der Ortschaften zerstörte diese Beziehung. Heute erschweren nicht zuletzt Sprachbarrieren ihre Wiederaufnahme. Die Enthusiasten aus Vlčkovás Verein „Krajina Novohradska“ stecken ihr Herzblut in diese Landschaft. Sie widmen sich sakralen Denkmälern und Pilgerwegen und verstehen die Gegend als Pilgerlandschaft. Sogar einen Reiseführer zu den Pilgerwegen brachten sie heraus. Vlčková betont, wie notwendig es ist, sich auch mit den Schicksalen jener zu befassen, die wegen der Grenzzone ihr Zuhause verlassen mussten.
Ein anspruchsvolles Projekt stellt Antonín Kolař vor. In Hochsemlowitz (Semněvice) richtet der Lehrer mit Familie, Schülern, Freiwilligen und Nachbarn einen barocken Pfarrkomplex wieder her. Die Pfarre soll ein lebendiger Ort für Zusammenkünfte und Ausbildungen werden. Seine Schilderung ist voller überraschender Anekdoten. Semlowitz, erzählt er, ist ein heißes Pflaster, viele junge Menschen haben dort keine Arbeit. Einige von ihnen konnte er als Helfer gewinnen. Analytisch und aufschlussreich beschreibt Kolař, weshalb die Wohnverhältnisse in dem Ort so prekär sind. „Ich bemerkte, dass gerade viele Menschen, die neue Schaffenskraft in die Sudeten bringen, von anderswo sind. Das sind Leute, die hier nicht aufgewachsen sind und diese Region mit anderen Augen sehen. Und ich denke, dass das eine großartige Gelegenheit ist dazu, dass die Alteingesessenen mit den Neuankömmlingen gemeinsam irgendeinen Wandel in Gang bringen.“ Die Sudeten beschreibt er als einen ausgekugelten Arm: „Es ist immer noch ein Arm, immer noch gibt es das volle Potenzial, aber die Beweglichkeit ging verloren und daraus ergibt sich die Aufgabe, etwas zu reparieren. […] Wenn neue Leute in die Sudeten kommen, zeigen sie den örtlichen Bewohnern, was diese Hand sonst noch alles machen kann …“
In Prachatitz (Prachatice) hat Barbora Koritenská eine verlassene Villa mit Hilfe eines Vereins in ein pulsierendes Haus verwandelt. Sie erzählt die Geschichte der Kralvilla von ihrer Errichtung in den 30er Jahren bis heute und spart dabei die teilweise recht merkwürdigen bürokratischen und lokalpolitischen Hindernisse, die ihrem Engagement wie Knüppel vor die Beine geworfen wurden, nicht aus. Letztendlich steht das Haus nun aber unter Denkmalschutz; der Verein ist Mieter und verwaltet die Kralvilla. Das gelang mit öffentlichem Druck, dem die skeptische Stadtverwaltung nicht standhalten konnte, mit Medienberichten und der Gründung einer eigenen Partei. Drei Mitstreiter sind inzwischen sogar als Stadträte tätig. In der Villa möchte sich Koritenská künftig auch tschechisch-deutschen Fragen widmen, „auch wenn das bestimmt nicht besonders beliebt sein wird.“
Radek Kocanda wollte schon immer Kastellan werden. Vor über zwanzig Jahren kaufte er sich schließlich seine eigene Ruine. Der Verein „Hrady na Malsi“ („Burgen an der Maltsch“) hat inzwischen mehrere mittelalterliche Denkmäler in Obhut – alles Ruinen. Neben Renovierung und öffentlichen Arbeitseinsätzen stehen kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte und Theateraufführungen im Zentrum der seiner Arbeit. Er betreibt sozusagen Burgendidaktik für Kinder und Jugendliche. Die Kooperation mit einem Zentrum für Kinder mit Behinderungen ist das Herzensprojekt des Vereins. Seine Erfahrungen mit den Burgprojekten gibt er bereitwillig an andere Initiativen weiter.
Dass und aus welchen Gründen engagierte Projekte im ehemaligen Sudetenland durchaus mit Widerständen rechnen müssen, geht aus den Gesprächen anschaulich hervor. Vor allem aber zeigen sie, wie sich diese Hindernisse erfolgreich überwinden lassen. Für alle Projekte geben die Autoren Profile in sozialen Medien oder Webseiten an. Man kann sich dort weiter inspirieren lassen oder die Gesprächspartner und die involvierten Vereine kontaktieren. Am besten aber fährt man hin. Wie die beiden Vorgänger ist auch der dritte Band von „Mitten am Rande“ ein wertvoller Reiseführer durch das heutige Sudetenland, zu Menschen, Landschaften und Geschichten. Ich habe das Buch gelesen, als ich auf der Rückfahrt von Böhmen nach Berlin war. Am liebsten wäre ich gleich wieder umgekehrt.
Der dritte Band wurde durch den „Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds“ und den „Jihočeský kraj“ (Südböhmische Region) gefördert. Bestellungen unter e-shop@antikomplex.cz; Nachfragen an Veronika Kupková unter kupkova@antikomplex.cz.
Bei Antikomplex ist der Band 3 leider ausverkauft [Stand: 28. Dezember 2025].
Der Beitrag ist auszugsweise erschienen in: Der Ackermann. Zeitschrift der Ackermann-Gemeinde. 76. Jahrgang, München, Heft 3/2025, Seite 17, sowie im Heimatbrief für die Bezirke Plan-Weseritz und Tepl-Petschau, Jänner/Feber 2026, Seiten 12-15.